Wenn alle wählen, verlieren die Populisten
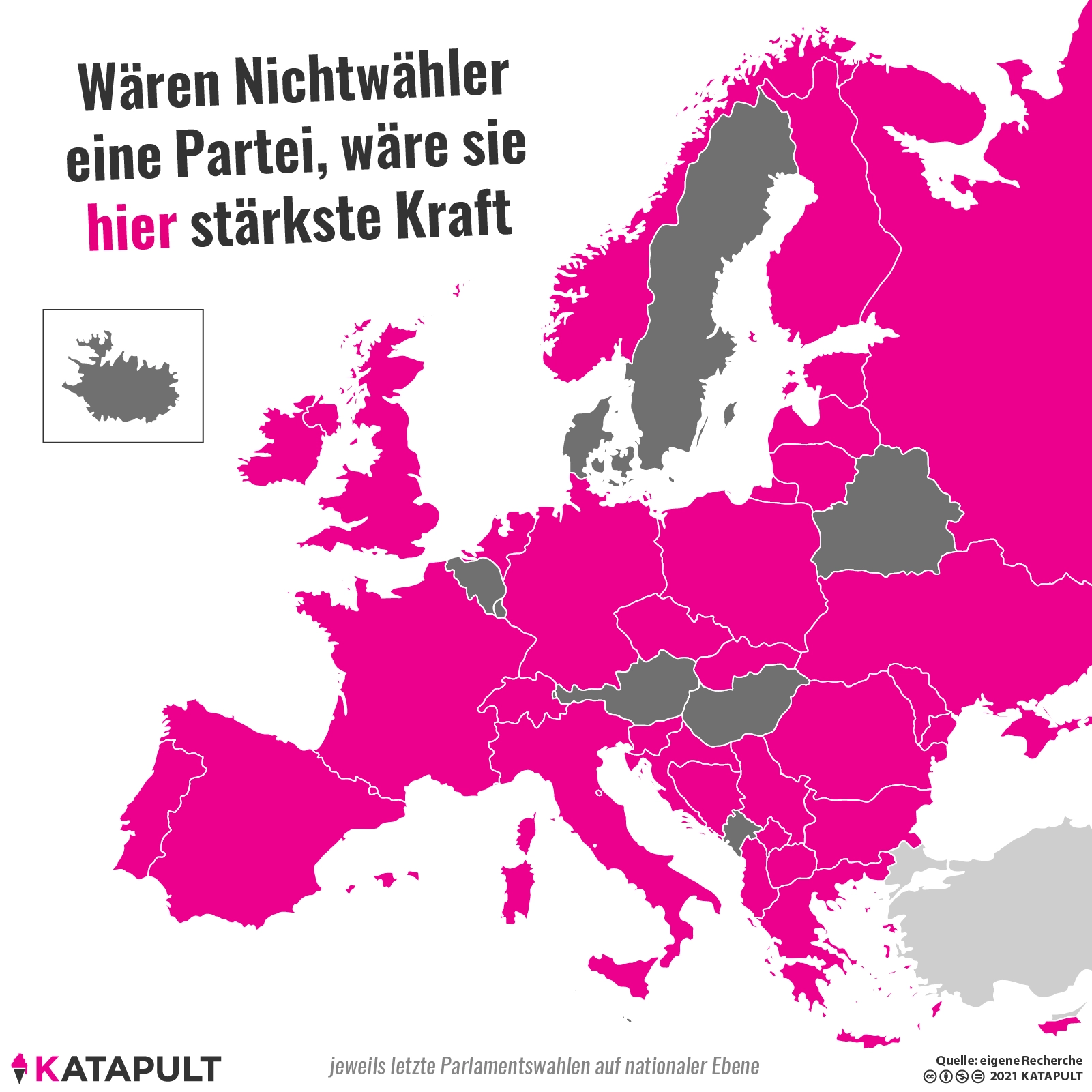
Die liberalen Demokratien Europas und Nordamerikas sehen sich seit Jahren einem Stresstest ausgesetzt. Populistische Parteien und Politiker rütteln an ihrem Wertefundament. Die Neuordnung des Justizwesens in Polen, die Beschneidung der Pressefreiheit in Ungarn, aber auch die aggressive Rhetorik Donald Trumps: Von Einzelfällen mag man nicht mehr reden.1 Angesichts dieser Entwicklungen liegt die Frage nahe, ob Europa und Nordamerika im “Zeitalter des Populismus” angekommen sind.2
SOLI
alle Artikel und Karten im Wiki
alle Magazine online und gedruckt
Spiele und Kommentare
Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können
BASIS
alle Artikel und Karten im Wiki
alle Magazine online und gedruckt
Spiele und Kommentare
Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können
6 €
/Monatalle Artikel und Karten im Wiki
alle Magazine online und gedruckt
Spiele und Kommentare
Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können