Was die Wissenschaft weiß und was die Medien daraus machen
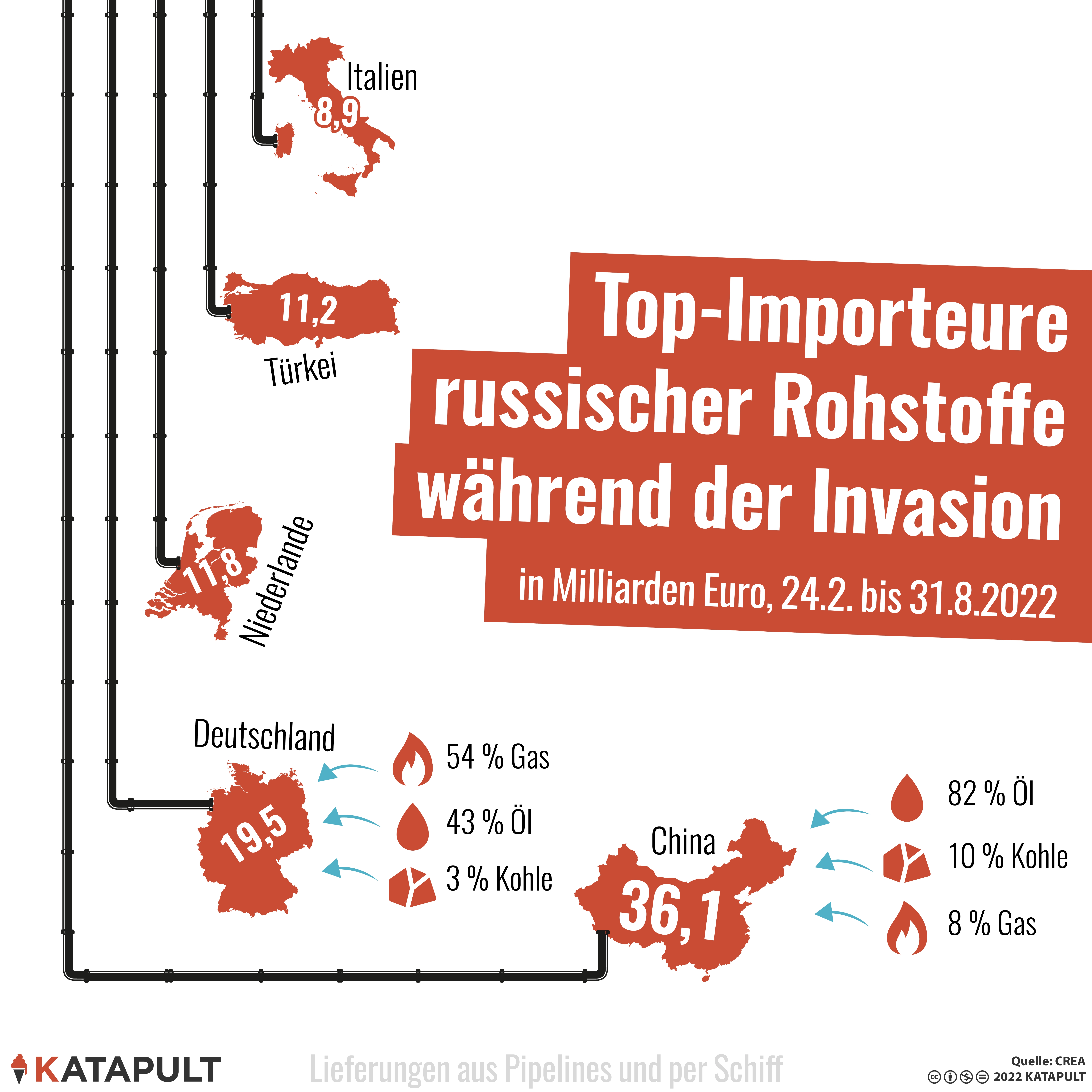
Neuerdings interessieren sich russische Nachrichten für deutsches Toilettenpapier. Was die Zeitungen wissen wollen, ist, ob auf dem hiesigen Lokus in Zukunft genügend Papier vorrätig sein wird. Der Aufhänger? Diesmal nicht Corona. Stattdessen geht es ums Gas. Die deutsche Papierindustrie ist auf den Rohstoff angewiesen – und der werde knapp. Und damit auch das
Hygieneprodukt! Dutzende russische Zeitungen griffen das Thema auf und titelten beispielsweise: »Deutschland steht wegen Gasmangels vor Toilettenpapierknappheit.«1
SOLI
alle Artikel und Karten im Wiki
alle Magazine online und gedruckt
Spiele und Kommentare
Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können
BASIS
alle Artikel und Karten im Wiki
alle Magazine online und gedruckt
Spiele und Kommentare
Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können
6 €
/Monatalle Artikel und Karten im Wiki
alle Magazine online und gedruckt
Spiele und Kommentare
Du unterstützt Leute, die sich kein Abo leisten können