Fake-Studien
Die Unterminierung der Forschung
Veröffentlicht am 03.07.2025
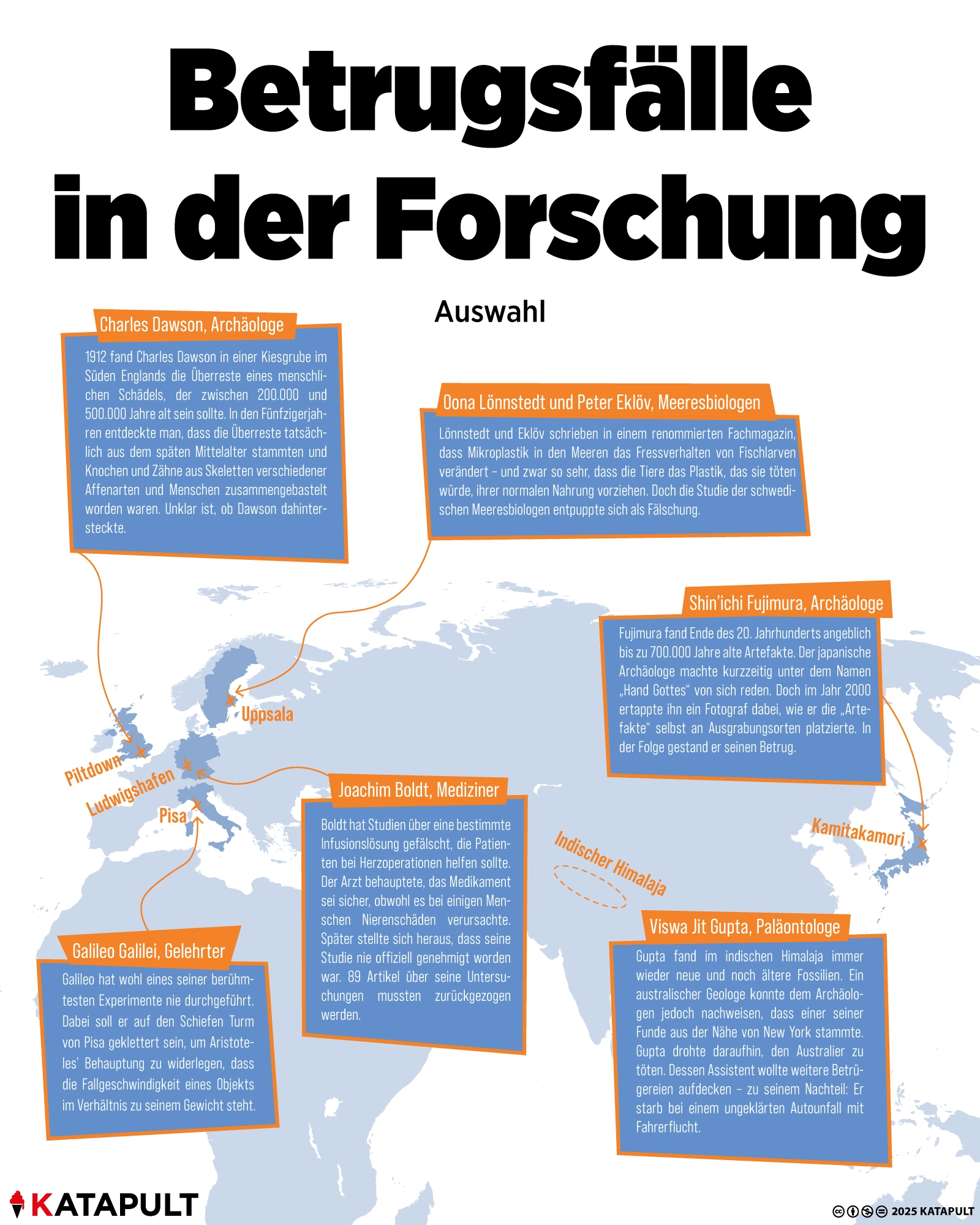
Paul Kammerer war bekannt für seine Krötenforschung. Doch seine Ergebnisse wurden Anfang der 1920er-Jahren von Kollegen angezweifelt. Sie warfen dem österreichischen Biologen vor, Kröten bemalt zu haben, um bestimmte Merkmale hervorzuheben.1 Obwohl sein Betrug nie einwandfrei bewiesen werden konnte und Kammerer die Vorwürfe vehement zurückwies, nahm er sich nach Bekanntwerden der Affäre das Leben.