Unternehmen Krankenhaus
Amputieren statt therapieren
Veröffentlicht am 23.06.2022
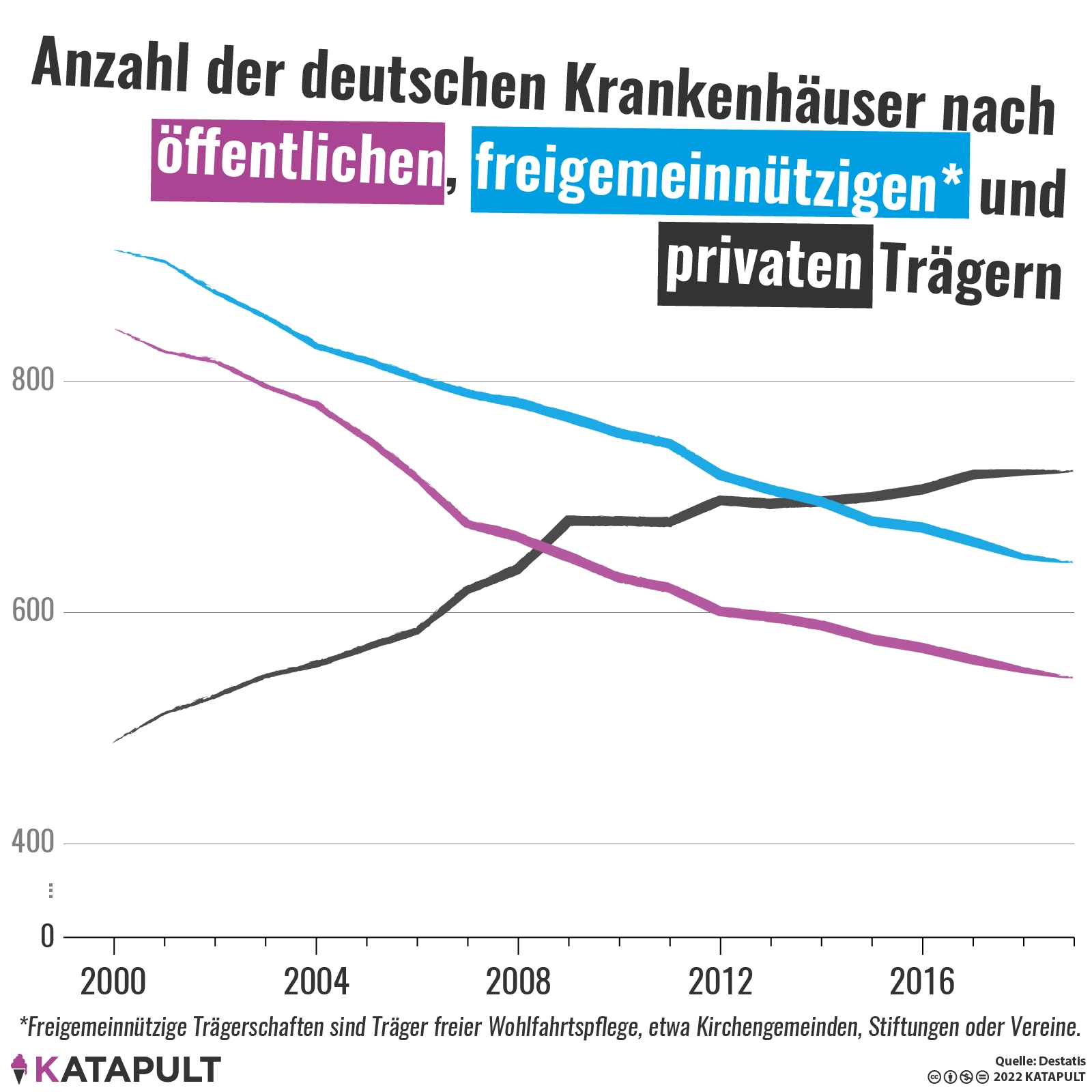
Stell dir vor, zwölf Tage am Stück arbeiten zu müssen. Danach zwei Tage frei, aber dann wieder zwölf Tage hintereinander arbeiten, dann zwei Tage frei und wieder zwölf arbeiten. Und immer so weiter. Klingt hart, aber im deutschen Gesundheitswesen ist das erlaubt. Pflegekräften wird dies besonders häufig abverlangt. Und das ist nur eine von vielen Widrigkeiten, die den Pflegeberuf unattraktiv machen und den Pflegenotstand verschärfen.